Wer will schon grenzenlose Freiheit?
Meine Klienten inspirieren mich immer wieder zu dem, was ich hier in diesem Blog schreibe. Und es geht sogar noch weiter: Oft bin ich nach einer Sitzung aufgekratzt und starte einen Blog, eine besondere Aktion oder schiebe etwas an, was ich schon länger vorhatte. Ja, meine Coaching-Klienten geben mir oft nicht nur Energie, sondern auch Inspiration. Denn Lernen durch Austausch enthält schon im Wording das Tauschgeschäft. An dieser Stelle also ein herzliches Dankeschön an alle, die mir ihr Vertrauen schenken und hoffentlich ebenso etwas mitnehmen.
In einem kürzlichen Coaching hat mich meine Klientin einmal mehr beeindruckt. Wir hatten schon ein paar Gespräche im Laufe dieses Jahres. Mit einer herausfordernden persönlichen Geschichte als Alleinerziehende mehrerer Kinder und voll im Berufsleben stehend schafft sie es, sich nicht nur in einem eher konservativen Umfeld zu bewähren und ihre Ideen einzubringen, sondern nebenher auch noch als Künstlerin auf der Bühne zu stehen. Und letztes Mal berichtete sie, dass sie sich ehrenamtlich für Jugendliche einsetzt, deren familiäres Umfeld ihre Startchancen eher einschränkt als fördert.
Das hat mich zu einigen Überlegungen von Grenzen und Freiheit veranlasst und mich an ein Experiment erinnert, über das ich in diesem Zusammenhang gehört habe. Kinder, die man auf eine große Wiese ohne Begrenzung zum Spielen setzt, bleiben in einem sehr kleinen Rahmen beieinander sitzen. Wenn die Wiese allerdings eine Grenze hat, einen Zaun, dann bewegen sich die Kinder in einem viel weiteren Radius, trauen sich und gehen bis zur Grenze oder probieren sogar, darüber hinaus zu kommen. Was heißt das?
Grenz-ziehung schafft Be-ziehung. Ich weiß dann, woran ich bin.
Das Konzept, dass erst Grenzen Freiheit ermöglichen können, mag auf den ersten Blick paradox erscheinen. Oft wird Freiheit als Abwesenheit von Grenzen verstanden – als völlige Ungebundenheit. Doch diese Idee ist lediglich ein gedankliches Konstrukt, da wir als Menschen immer in Strukturen agieren und klar definierte Grenzen offensichtlich eine wichtige Grundlage für unser Handeln darstellen.
Nehmen wir zum Beispiel die Kinder auf der großen Wiese: Wenn sie wissen, dass die Wiese eine Grenze hat, fühlen sie sich sicherer. Diese Sicherheit erst ermöglicht es ihnen, sich weiter auszudehnen und zu entdecken, wie weit sie tatsächlich gehen können. Ähnlich verhält es sich doch im Erwachsenenleben auch: Erst wenn wir klare Grenzen für unsere Zeit, für unsere Energie und unsere Ressourcen haben, können wir uns selbst den Raum geben, kreativ zu sein und neue Möglichkeiten zu entdecken. Selbst unsere Grenzen in den beruflichen Rollen folgen diesem Konzept: Sie geben den Rahmen und lassen auch Freiheit. Meine Erkenntnis aus vielen Coachings und eigener Erfahrung: Es ist immer viel mehr möglich, als ich mir selbst gestatte oder zutraue.
Innere Grenzen sind oft härter als die äußeren
Ein wichtiger Aspekt, an dem ich regelmäßig und in allen Prozessen mit meinen Klienten arbeite, ist die Frage, ob ein gefühltes Limit wirklich gesetzt ist oder nur in meinem Kopf existiert. Diese gefühlten Grenzen sind meist das Ergebnis von falschen Hypothesen oder Überzeugungen. Das können einerseits Hypothesen oder Befürchtungen sein, die wir über uns selbst oder unsere Fähigkeiten entwickeln. Gedanken wie „Das kann ich doch niemanden so offen sagen…“ oder „Das habe ich gar nicht verdient…“ oder „Was werden die anderen denken, wenn ich so voran gehe?“ sind Beispiele für innere Barrieren, die uns daran hindern, unsere Grenzen zu erweitern. Oft sind es andererseits auch Vorannahmen über andere oder deren Reaktionen, die uns abhalten, etwas zu tun oder zu adressieren, was wir „eigentlich“ gerne tun würden. Zum Beispiel im Business dem Vorstand als Vorgesetzten auch einmal widerspiegeln, was er oder sie selbst verändern müssten, weil es kontraproduktiv wirkt.
Innere Grenzen zu hinterfragen bedeutet, die eigene Begrenzung zu erkennen und zu verstehen, woher sie kommt. Darin liegt die Freiheit, die wir haben und die es zu nutzen gilt. Oft haben diese Annahmen weniger mit der Gegenwart als viel mehr mit der Vergangenheit zu tun. Manchmal geht es um lange verwurzelte religiöse, persönliche oder kulturelle Prägungen oder um den tief verankerten Wunsch, lediglich die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen.
Freiheit durch Selbstreflexion
Wenn wir anfangen, diese inneren Grenzen zu reflektieren und zu hinterfragen, eröffnen wir uns neue Möglichkeiten. Zu erkennen, dass es falsche Hypothesen sind, und andere Hypothesen uns mehr erlauben, als wir uns bisher selbst erlaubt haben, kann sprichwörtlich die Tür öffnen, die die Grenze ein Stück verschiebt. Das passiert nur durch Selbstreflexion und Austausch. Der Weg zur Freiheit besteht darin, den Wahrheitsgehalt der eigenen inneren Überzeugungen zu hinterfragen.
Bei meiner Klientin führte unser Austausch dazu, dass sie sich erlaubte, trotz aller Fürsorge für die Kinder und trotz der Notwendigkeit für einen Brot-und-Butter-Job auch ihren künstlerischen Anspruch zu leben, der ihr wiederum Antrieb für andere Bereiche zurückgibt.
Die Synergie von Grenzen und Freiheit
Grenzen sind also nicht nur unangenehme Einschränkungen, sondern auch Einladungen, andere Möglichkeiten auszuloten oder gar zu schaffen. In der Psychologie und der Lerntheorie spricht man von der „Zone der proximalen Entwicklung“ und meint den Bereich zwischen dem, was ein Lernender alleine und ohne Hilfe kann und dem, was er mit kompetenter Anleitung oder in Zusammenarbeit mit anderen entwickeln kann, letztlich der Bereich, in dem das Lernen und Wachsen durch gezielte Förderung optimal entwickelt wird.
Meine Klienten arbeiten immer in einem System mit klaren (oder nur klar erscheinenden) Grenzen. Gleichzeitig sind alle meine Klienten Führungskräfte, deren Job es letztlich ist, Kultur zu gestalten und damit natürlich auch Grenzen auszuloten oder durch deren Verschiebung Veränderungen zu bewirken. Die „gefühlten“ Grenzen sind oft der Schlüssel zu den wirklichen Veränderungen und den Freiheiten, die jede noch so fest determinierte Rolle eben auch hat. Es ist also das Zusammenspiel von Freiheit und Grenzen, das uns letztlich erlaubt, etwas zu bewegen.
Ich war noch nie und werde wahrscheinlich in meinem Leben kein „Alles-ist-möglich, wenn man nur will“-Coach werden. Aber der Gedanken der Gestaltung und der Verschiebung von Grenzen durch Ermutigung, durch gezieltes Stärken, Hinterfragen und Aus-Tausch, das ist und bleibt mein Credo. Es geht so viel mehr, wenn ich Menschen finde, die mir helfen, meine Grenze zu verschieben. Und der Weg dahin ist oft, dass ich anderen helfe, ihre Grenze zu verschieben. Meine Klientin hat mich übrigens dazu inspiriert, mich ebenfalls ehrenamtlich zu betätigen.
Mein Cousin ist Winzer und seinen jährlichen Wein-Brief beendet er immer mit den Worten: „Verflixt schönes Winzerleben“. Für mich heißt es: verflixt schönes Coach-Leben, weil ich solche Prozesse anstoßen und begleiten darf.
In diesem Sinne, nutzen Sie Ihre Chance, indem Sie gemeinsam Grenzen verschieben.

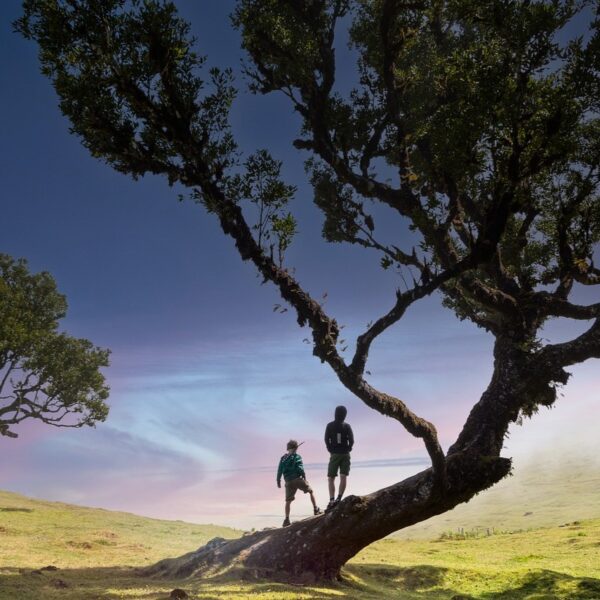
 Der Glaubenskrieg um die Business-Traditionen
Der Glaubenskrieg um die Business-Traditionen Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcher Mechanismus zuschlägt, wenn Sie merken, dass Sie bestimmten Menschen einfach nicht zuhören können? Wenn Sie zwar die Worte hören, aber die Worte weder Ihr Hirn noch Ihr Herz erreichen? Wenn Sie abschalten, stellen Sie die Ohren auf Durchzug, wie der Volksmund sagt. Wir kennen dieses Phänomen alle. Wir üben es quasi von Kindheit an. Es gibt einfach Botschaften, auf die wir keine Lust haben oder auch die, vor denen wir uns schützen wollen und manchmal auch müssen. Und es gibt andere Wahrheiten, die uns – bitteschön – nicht angreifen sollen.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welcher Mechanismus zuschlägt, wenn Sie merken, dass Sie bestimmten Menschen einfach nicht zuhören können? Wenn Sie zwar die Worte hören, aber die Worte weder Ihr Hirn noch Ihr Herz erreichen? Wenn Sie abschalten, stellen Sie die Ohren auf Durchzug, wie der Volksmund sagt. Wir kennen dieses Phänomen alle. Wir üben es quasi von Kindheit an. Es gibt einfach Botschaften, auf die wir keine Lust haben oder auch die, vor denen wir uns schützen wollen und manchmal auch müssen. Und es gibt andere Wahrheiten, die uns – bitteschön – nicht angreifen sollen.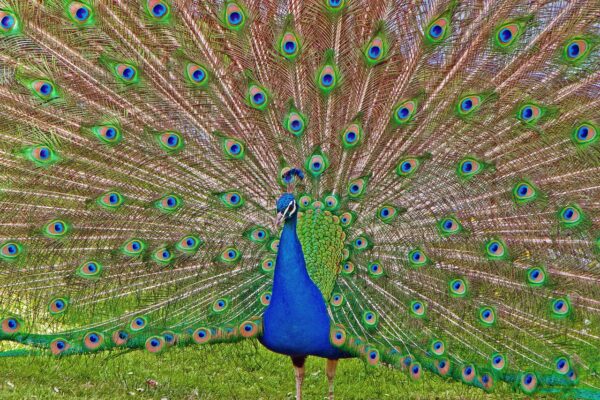
 In meiner Coachingpraxis heute und auch schon früher als Headhunterin habe ich immer wieder festgestellt, dass einige Charaktere erst dann aufblühen, wenn sie vor richtig schwierigen, druckvollen, anspruchsvollen Megaaufgaben stehen. Erst in einer richtigen Krise können diese Menschen bei sich selbst entdecken, was sie können und auszuhalten imstande sind, gerade auch im direkten Vergleich mit anderen. Da ich immer wieder fasziniert von dieser Beobachtung war, habe ich dazu recherchiert und einige Hypothesen haben sich verfestigt.
In meiner Coachingpraxis heute und auch schon früher als Headhunterin habe ich immer wieder festgestellt, dass einige Charaktere erst dann aufblühen, wenn sie vor richtig schwierigen, druckvollen, anspruchsvollen Megaaufgaben stehen. Erst in einer richtigen Krise können diese Menschen bei sich selbst entdecken, was sie können und auszuhalten imstande sind, gerade auch im direkten Vergleich mit anderen. Da ich immer wieder fasziniert von dieser Beobachtung war, habe ich dazu recherchiert und einige Hypothesen haben sich verfestigt.

 Für uns alle hält das Leben einen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen und Ereignissen parat. Einige sind schön, angenehm und inspirierend, andere sind schlimm, unangenehm und niederdrückend. Und manchmal fragen wir uns, warum gerade uns etwas passiert – in der Regel bei den unangenehmen und nicht bei angenehmen Situationen. So wie zwei meiner Klienten kürzlich:
Für uns alle hält das Leben einen bunten Blumenstrauß an Erfahrungen und Ereignissen parat. Einige sind schön, angenehm und inspirierend, andere sind schlimm, unangenehm und niederdrückend. Und manchmal fragen wir uns, warum gerade uns etwas passiert – in der Regel bei den unangenehmen und nicht bei angenehmen Situationen. So wie zwei meiner Klienten kürzlich: In meiner Coaching-Praxis ist einer der spannendsten Momente für mich, wenn ich neue Klient.innen kennenlerne und wir über die Ziele des Prozesses sprechen. Dem geht in der Regel voraus, dass ich mir einige Unterlagen angesehen habe (CV, ggf. Management Appraisel, Organigramm, Jobdescription, meinen Vorab-Fragebogen etc.) und wir ein Kennenlerngespräch hatten. Meine Arbeitshypothesen zu den Zielen meiner Klienten haben sich in der Regel dann schon geformt. Spannend ist der Abgleich meiner Hypothesen mit den Wünschen und Zielen meines Klienten. Denn die angegebenen Ziele entpuppen sich häufig ähnlich wie der Eisberg in der Kommunikationstheorie: Was wir als Äußerung hören, ist oft nur die Spitze des Eisberges und der große Rest ist unterhalb der Oberfläche verborgen.
In meiner Coaching-Praxis ist einer der spannendsten Momente für mich, wenn ich neue Klient.innen kennenlerne und wir über die Ziele des Prozesses sprechen. Dem geht in der Regel voraus, dass ich mir einige Unterlagen angesehen habe (CV, ggf. Management Appraisel, Organigramm, Jobdescription, meinen Vorab-Fragebogen etc.) und wir ein Kennenlerngespräch hatten. Meine Arbeitshypothesen zu den Zielen meiner Klienten haben sich in der Regel dann schon geformt. Spannend ist der Abgleich meiner Hypothesen mit den Wünschen und Zielen meines Klienten. Denn die angegebenen Ziele entpuppen sich häufig ähnlich wie der Eisberg in der Kommunikationstheorie: Was wir als Äußerung hören, ist oft nur die Spitze des Eisberges und der große Rest ist unterhalb der Oberfläche verborgen.